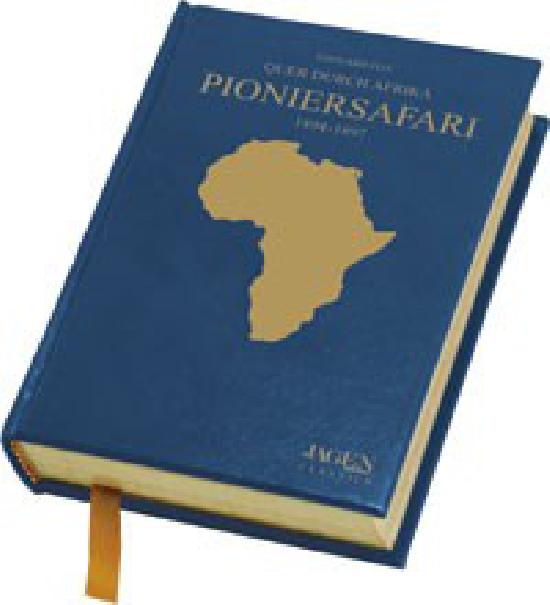PIONIERSAFARI 1894 – 1897
Hier ein Kapitel aus Édouard Foà: After Big Game in Central Africa
Aus dem Englischen und Französischen von Erhard C. J. Weber
Chiromo, Sambesi-Delta, Ostafrika, September 1894. Die Jahreszeit war schon ziemlich weit fortgeschritten, als wir den Ort Chiromo am River Shire erreichten, einem nördlichen Zufluss des mächtigen Sambesistromes. Jetzt, gegen Mitte September, würde sich eine ernsthafte Unternehmung in diesem Jahr kaum mehr lohnen: Die gute Jagdsaison endete für gewöhnlich im November und wich einer ausgiebigen Regenperiode mit hohem Gras und zahlreichen Sümpfen.
Demzufolge war es notwendig, sich auf den Winter vorzubereiten wie es die Menschen in gewissen Teilen Afrikas nennen; dies bedeutete, unter einem schützenden Dach die Regenzeit zu verbringen die in Wirklichkeit den Sommer darstellt.
Chiromo erschien uns als bequemer Platz, wo wir unser Lager aufschlagen konnten. Drei Monate später mussten wir diesen Ort fluchtartig verlassen, nachdem wir zuerst von Heuschrecken heimgesucht worden waren, die das Land verwüsteten, danach von einer Feuersbrunst, die uns selbst beinahe vernichtete und zuletzt vom Hochwasser, das uns fast das Leben kostete. So zog unsere Expedition weiter gen Westen und gelangte in jenes Gebiet der Magandjas, das schon die Stätte unserer früheren jagdlichen Taten darstellte.
Während des Aufenthaltes in Chiromo war ich unverzüglich darangegangen, meine alte Jagdmannschaft zu reorganisieren. Botschafter wurden in jene Distrikte entsandt, wo Msiambiri, Rodzani, Tchigallo und Tambarika lebten, um ihnen mitzuteilen, dass ich zurückgekommen war und erneut auf sie zählte. Schon im Buch Mes Grandes Chasses sind diese Burschen häufig erwähnt; allein, ich kann ihre mir geleisteten treuen Dienste nicht oft genug preisen.
Im Verlauf von insgesamt sieben langen Jagdjahren kam kein einziges Stück Wild ohne die Mithilfe meiner Jäger zur Strecke. Es gab weder Freuden oder Triumphe, an denen sie nicht teilnahmen, noch Mühen, die sie nicht gemeinsam mit mir durchstanden. Freilich schossen meine Leute nicht selbst mit der Büchse; aber sie lehrten mich, den Spuren des Wildes zu folgen und halfen mir dann auch noch bei meinen wissenschaftlichen Forschungen.
Während des Aufenthaltes in Chiromo war ich unverzüglich darangegangen, meine alte Jagdmannschaft zu reorganisieren. Botschafter wurden in jene Distrikte entsandt, wo Msiambiri, Rodzani, Tchigallo und Tambarika lebten, um ihnen mitzuteilen, dass ich zurückgekommen war und erneut auf sie zählte. Schon im Buch Mes Grandes Chasses sind diese Burschen häufig erwähnt; allein, ich kann ihre mir geleisteten treuen Dienste nicht oft genug preisen.
Im Verlauf von insgesamt sieben langen Jagdjahren kam kein einziges Stück Wild ohne die Mithilfe meiner Jäger zur Strecke. Es gab weder Freuden oder Triumphe, an denen sie nicht teilnahmen, noch Mühen, die sie nicht gemeinsam mit mir durchstanden. Freilich schossen meine Leute nicht selbst mit der Büchse; aber sie lehrten mich, den Spuren des Wildes zu folgen und halfen mir dann auch noch bei meinen wissenschaftlichen Forschungen.
Kein Großwild
Leider war in der unmittelbaren Umgebung unseres Chiromo-Camps praktisch überhaupt kein Großwild vorhanden. Am gegenüberliegenden, linken Flussufer befand sich eine offene Ebene: Unglückselige Büffel, die darauf beharrten, sich dort aufzuhalten, wurden an dieser Stelle von örtlichen Sportsleuten abgeknallt; letztere ließen sich von kreischenden Bediensteten, bekleidet mit weißen Hemden und roten Kappen, auf Hängematten tragen und feuerten daraus auf das Wild.
Die Lokalverwaltung bereitete zwar durch behördliches Verbot dieser üblen Schlächterei ein Ende, trotzdem gab es immer noch Pseudojäger, die an einem einzigen Morgen sieben oder acht Büffel schossen, ohne sich der Mühe zu unterziehen, das Wildbret auch zu bergen. Derzeit wird dieses Gebiet in ein Jagdreservat umgewandelt.
Leider war in der unmittelbaren Umgebung unseres Chiromo-Camps praktisch überhaupt kein Großwild vorhanden. Am gegenüberliegenden, linken Flussufer befand sich eine offene Ebene: Unglückselige Büffel, die darauf beharrten, sich dort aufzuhalten, wurden an dieser Stelle von örtlichen Sportsleuten abgeknallt; letztere ließen sich von kreischenden Bediensteten, bekleidet mit weißen Hemden und roten Kappen, auf Hängematten tragen und feuerten daraus auf das Wild.
Die Lokalverwaltung bereitete zwar durch behördliches Verbot dieser üblen Schlächterei ein Ende, trotzdem gab es immer noch Pseudojäger, die an einem einzigen Morgen sieben oder acht Büffel schossen, ohne sich der Mühe zu unterziehen, das Wildbret auch zu bergen. Derzeit wird dieses Gebiet in ein Jagdreservat umgewandelt.
Um an Wild zu gelangen, musste man von Chiromo wegkommen, und zwar westwärts in Richtung der britisch-portugiesischen Grenze, wo noch ein paar Büffel und Antilopen standen. Zwecks Erprobung meiner eben erst erworbenen .303 Metford marschierte ich also in diese Region und nahm in Nantana, einem knapp sieben Meilen entfernten Dorf, Quartier.
Am folgenden Morgen bot mir eine Herde Harteebests (Kuhantilopen) auf ihre Kosten! Gelegenheit zu einigen überzeugenden Experimenten. Die kleinkalibrige Büchse schien mir außerordentlich wirksam zu sein; ihre Präzision war perfekt, ein Rückstoß nahezu nicht vorhanden. Fast mit jedem Scuss erlegte ich ein Stück Wild.
Am folgenden Morgen bot mir eine Herde Harteebests (Kuhantilopen) auf ihre Kosten! Gelegenheit zu einigen überzeugenden Experimenten. Die kleinkalibrige Büchse schien mir außerordentlich wirksam zu sein; ihre Präzision war perfekt, ein Rückstoß nahezu nicht vorhanden. Fast mit jedem Scuss erlegte ich ein Stück Wild.
Nun gilt das Lichtenstein Hartebeest seine Schulterhöhe entspricht der eines kleinen Pferdes als überaus schusshart: Es ist eine der Antilopenarten, die nur sehr schwer zur Strecke zu bringen sind so schwer, dass die Buren es harte-beest tauften, was zähes Tier bedeutet.
Spätere Erfahrungen lehrten mich dann die Vor- und Nachteile bestimmter Geschosstypen der .303, aber insgesamt war ich jedenfalls von meiner neuen Waffe begeistert; sie erwies sich als voller Erfolg. Das Fehlen von Pulverqualm brachte zudem einen bedeutenden Vorteil mit sich: Aufgrund des Schussechos erkannte das Wild nie genau den Standort des Schützen sofern dieser nur regungslos blieb.
Elandjagd
Innerhalb weniger Tage schoss ich nacheinander Hartebeests, Zebras, Impalas sowie ein Eland. Letzteres wurde unter Bedingungen erlegt, die deutlich den Wert meines neuen Jagdgewehrs in Bezug auf Reichweite und Präzision aufzeigten: Es war in der Umgebung von Nantana, wo Elands nur recht selten vorkommen. Eines Morgens erspähte ich jedoch ein solches auf einer Grasebene, freilich mehr als 400 Yards weit entfernt.
Innerhalb weniger Tage schoss ich nacheinander Hartebeests, Zebras, Impalas sowie ein Eland. Letzteres wurde unter Bedingungen erlegt, die deutlich den Wert meines neuen Jagdgewehrs in Bezug auf Reichweite und Präzision aufzeigten: Es war in der Umgebung von Nantana, wo Elands nur recht selten vorkommen. Eines Morgens erspähte ich jedoch ein solches auf einer Grasebene, freilich mehr als 400 Yards weit entfernt.
Jenes Eland nahm uns augenblicklich wahr; zwar hatten wir uns sofort im Gras niedergekauert, doch verhoffte es jedes Mal starr in unsere Richtung, sobald wir uns nur ein wenig aus der Deckung erhoben. Ich beschloss, alles nur irgend Mögliche zu unternehmen, um die .303 auch auf dieses prächtige Wild zu erproben. Es erreicht das Gewicht eines unserer Hausochsen sowie die Schulterhöhe eines Gardepferdes.
Fraglos musste ich näher an das Wild herankommen, aber dies stellte kein leichtes Unterfangen dar. Bei genauerer Überprüfung des Terrains entdeckten wir zu unserer Rechten eine kleine Baumgruppe, die sich allerdings rund 200 Yards hinter der Antilope befand. Ich wartete, bis sich der Argwohn meines Gegenspielers etwas gelegt hatte, und dieser anfing zu äsen. Dann begann ich, auf allen Vieren kriechend, mit der erforderlichen kreisförmigen Umgehung. Sie nahm beträchtliche Zeit in Anspruch, bis ich endlich in die Verlängerung der Linie vom Eland zur besagten Baumgruppe gelangte. Im Schutz dieser natürlichen Sichtdeckung erreichte ich wohl vom Wild unbemerkt jene Bäume, doch von da ab gab es wirklich kein Vorwärtskommen mehr: Der Grasbewuchs war viel zu niedrig, sodass jeder weitere Schritt meine bisherigen Bemühungen zunichte gemacht hätte.
Andererseits drehte sich die riesige Antilope mittlerweile ein bisschen; sie spürte offensichtlich die ihr drohende Gefahr und sicherte unentwegt auf jenen Punkt hin, wo sie uns zuerst eräugt hatte. Die Distanz betrug nach wie vor an die 200 Yards, für weiteres Zögern blieb jetzt keine Zeit mehr. Direkt hinter einem der Baumstämme richtete ich mich langsam auf, zielte sorgfältig und drückte ab.
Im Schuss schlug das Eland mit den Hinterläufen aus, warf sich nach rechts und stürmte hochflüchtig davon. Ich war mir meines Treffers sicher, befürchtete jedoch die Großantilope nur leicht angeschweißt zu haben. Noch konnte ich ihr mit meinen Augen folgen und beobachten, wie sie das Tempo von hochflüchtig in ein träges Ziehen reduzierte. Dann überschlug sich das Eland plötzlich im Gras, schlegelte noch einen Moment mit allen vier Läufen und verschwand. Als wir nach wenigen Minuten eilends zur Stelle waren, fanden wir es verendet. Das Geschoss hatte das Herz getroffen, und dort große Zerstörungen hinterlassen.
Obwohl mit der Treffgenauigkeit meiner Büchse äußerst zufrieden, erachtete ich diesen Versuch nicht als maßgebend, denn alles Wild ist mit Herzschuss unwiderruflich dem Tode geweiht egal, welche Waffe oder welches Geschoss Verwendung fanden. Später erkannte ich aus Erfahrung, dass die Elandantilope für .303er Projektile zu stark ist, und vielmehr die .577 Express jene Waffe darstellt, mit der man dieses Wild ohne allzuviel Schwierigkeiten und Zeitverlust am besten zur Strecke bringt. Zum Erlegen von starkem Großwild braucht man nämlich ein Geschoss mit heftiger Schockwirkung, die von kleinkalibrigen Projektilen jedoch nicht erreicht wird.
Einige Zeit danach organisierte ich eine kleine Expedition in das nordöstlich unseres Lagers gelegene, portugiesische Territorium rund um den Chiperoni-Berg; es war dies eine Reise von fünf oder sechs Tagen. Dort fanden wir extrem hohes, nahezu undurchdringliches Grasland vor, obwohl ein Unterwuchs von solcher Dichte um diese Jahreszeit keineswegs üblich ist. Wir stießen auf zahlreiche Wildfährten unter anderem auch von Wildebeests (Gnus), deren Vorkommen ich hier erstmals nördlich des Sambezi entdeckte. Elefanten hatten dieses Gebiet ebenfalls aufgesucht, wenngleich ihre Fährten ziemlich alt schienen. Des weiteren lebten in der Gegend etliche Nashörner, wobei wir eines Tages sogar in die unmittelbare Nähe eines von ihnen gerieten.Doch war die Vegetation rundum derart dicht und das Gras so hoch, dass wir den Dickhäuter selbst nach mehrstündiger Verfolgung nicht in Anblick bekommen konnten.
Die Umgebung unseres Camps erwies sich als allgemein enttäuschend. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass mit dem ersten Regenfall Wild in die Region nordwestlich von Chiromo einwechseln würde und schließlich trennten uns ja nur noch etwa 14 Tage von jenem Zeitpunkt, zu dem der Himmel seine Schleusen für eine Periode von vier Monaten öffnen sollte.
Die Umgebung unseres Camps erwies sich als allgemein enttäuschend. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass mit dem ersten Regenfall Wild in die Region nordwestlich von Chiromo einwechseln würde und schließlich trennten uns ja nur noch etwa 14 Tage von jenem Zeitpunkt, zu dem der Himmel seine Schleusen für eine Periode von vier Monaten öffnen sollte.
In der Zwischenzeit begann ich damit, an den Ufern des Shire Flusspferde zu bejagen. Ich hatte bislang nur die Zähne meiner stärksten Hippos aufbewahrt und benötigte für meine Sammlung noch ein möglichst kapitales, komplettes Flusspferdhaupt. Eine Trophäe, wie ich sie suchte, fand sich indes damals nicht, obwohl zu dieser Jahreszeit viel Auswahl bestand: Ein kleines Stück unterhalb des Zusammenflusses von Shire und Rui hatte sich nämlich eine beträchtliche Anzahl von Hippos versammelt. Allein, jene welche ich erlegte, waren entweder zu jung oder, im Fall der alten Exemplare, die Zähne bereits abgenutzt.
Menschenfresser-Krokodile
Während dieser wenigen Tage an den Ufern des Flusses vergnügten sich meine Gefährten mit der Jagd auf Krokodile. An einem Vormittag, als wir gerade beim Lunch saßen, wurde ein solches, frisch erlegtes Reptil von beachtlichen Ausmaßen soeben an Land geschleppt. Plötzlich kamen die Leute angerannt und berichteten uns, im Magen des Ungeheuers befände sich ein Mann. Bei näherer Überprüfung trat zutage, dass die Eingeweide zumindest Teile eines menschlichen Körpers enthielten. Ein Arm mit daran befindlicher Hand, des weiteren ein Fuß samt Knöchel sowie ein paar Rippen wurden herausgezogen. All diese Leichenteile waren sauber vom Körper abgetrennt und kaum beschädigt, obschon unter der Wirkung der Magensäfte zumal vom Tageslicht abgeschirmt das Fleisch geschwollen und die Haut verfärbt schienen.
Ich ordnete die Bestattung dieser Überreste an, aber niemand wollte sie auch nur anrühren. Also ließ ich alles Krokodil samt Inhalt zurück in den Fluss werfen. Die menschlichen Überreste schwammen weiterhin an der Oberfläche, sodass die Matrosen eines Kanonenbootes, das stromabwärts anlegte, ihrem Offizier berichteten, sie hätten den Arm eines weißen Mannes die Flussströmung hinabtreiben gesehen. Diese Nachricht rief im Bezirk große Aufregung hervor. Am darauf folgenden Tag wurde ein anderes Krokodil erlegt, das den Kopf und die Schultern des Mannes enthielt, den wir am Vortag gefunden hatten. Jene Entdeckungen veranlassten mich, künftig sämtliche von mir geschossenen Krokodile öffnen zu lassen.
Während dieser wenigen Tage an den Ufern des Flusses vergnügten sich meine Gefährten mit der Jagd auf Krokodile. An einem Vormittag, als wir gerade beim Lunch saßen, wurde ein solches, frisch erlegtes Reptil von beachtlichen Ausmaßen soeben an Land geschleppt. Plötzlich kamen die Leute angerannt und berichteten uns, im Magen des Ungeheuers befände sich ein Mann. Bei näherer Überprüfung trat zutage, dass die Eingeweide zumindest Teile eines menschlichen Körpers enthielten. Ein Arm mit daran befindlicher Hand, des weiteren ein Fuß samt Knöchel sowie ein paar Rippen wurden herausgezogen. All diese Leichenteile waren sauber vom Körper abgetrennt und kaum beschädigt, obschon unter der Wirkung der Magensäfte zumal vom Tageslicht abgeschirmt das Fleisch geschwollen und die Haut verfärbt schienen.
Ich ordnete die Bestattung dieser Überreste an, aber niemand wollte sie auch nur anrühren. Also ließ ich alles Krokodil samt Inhalt zurück in den Fluss werfen. Die menschlichen Überreste schwammen weiterhin an der Oberfläche, sodass die Matrosen eines Kanonenbootes, das stromabwärts anlegte, ihrem Offizier berichteten, sie hätten den Arm eines weißen Mannes die Flussströmung hinabtreiben gesehen. Diese Nachricht rief im Bezirk große Aufregung hervor. Am darauf folgenden Tag wurde ein anderes Krokodil erlegt, das den Kopf und die Schultern des Mannes enthielt, den wir am Vortag gefunden hatten. Jene Entdeckungen veranlassten mich, künftig sämtliche von mir geschossenen Krokodile öffnen zu lassen.
Zwei Jahre später wurden am Lake Nyassa dem Magen eines gigantischen Krokodils von über sechs Yard Länge ein ganzes Sortiment von 24 kupfernen Armreifen sowie ein großer Knäuel gekräuselter Haare entnommen; das schreckliche Reptil war nicht imstande gewesen, diese makabren Fundstücke zu verdauen, nachdem es deren einstmalige Besitzerin verschlungen hatte.
Der Leser muss denken, hier kommen nun endlich les horreurs qui commencent (die erwarteten Horrorgeschichten) wie es in einem bekannten Lied so schön heißt. Alas! Es tut mir Leid, aber das war auch schon alles, was ich über Chiromo zu berichten habe; unser restlicher Aufenthalt in diesem Gebiet war aus jagdlicher Sicht so gänzlich uninteressant, dass wir ohne weitere Umschweife zum Februar des nächstfolgenden Jahres, also 1895, überwechseln wollen vom Shire weg, 270 Meilen weit mitten in ein Land voll Großwild im Überfluss!
Der Leser muss denken, hier kommen nun endlich les horreurs qui commencent (die erwarteten Horrorgeschichten) wie es in einem bekannten Lied so schön heißt. Alas! Es tut mir Leid, aber das war auch schon alles, was ich über Chiromo zu berichten habe; unser restlicher Aufenthalt in diesem Gebiet war aus jagdlicher Sicht so gänzlich uninteressant, dass wir ohne weitere Umschweife zum Februar des nächstfolgenden Jahres, also 1895, überwechseln wollen vom Shire weg, 270 Meilen weit mitten in ein Land voll Großwild im Überfluss!
Der Regen hört auf
Wie Zuschauer im Theater wird jetzt der Leser mühelos in eine völlig andere Szenerie versetzt: Drei Monate lang hat es unaufhörlich geregnet; das frische Gras ist schon zwei Fuß hoch, und die Bäume sind schwerbeladen manche mit Blättern, andere mit wilden Früchten. Zwischen einzelnen Regenschauern klart der Himmel auf mit einem Wort: Es herrscht Sommer.
Wie Zuschauer im Theater wird jetzt der Leser mühelos in eine völlig andere Szenerie versetzt: Drei Monate lang hat es unaufhörlich geregnet; das frische Gras ist schon zwei Fuß hoch, und die Bäume sind schwerbeladen manche mit Blättern, andere mit wilden Früchten. Zwischen einzelnen Regenschauern klart der Himmel auf mit einem Wort: Es herrscht Sommer.
Dies ist die beste Jahreszeit für die Jagd auf Elefanten und Büffel; hingegen die schlechteste in Bezug auf Löwen, vor denen man sich nunmehr am meisten in Acht nehmen muss. Es ist überdies die Periode, wo man überall herumplanscht und nichts trocken ist, du dein Leben damit zubringst, nass zu werden und dich wieder zu trocknen.
Unser Lager liegt auf einem sanften Hügel zwischen zwei kleinen, auf feinem Sand dahinplätschernden Flüssen. Wir haben es mit Verhauen aus Ästen und Dornenzweigen verbarrikadiert, die uns wie ein Schutzwall umgeben. Das Camp besteht aus vier Zelten und zehn Unterständen mit Grasdach. De Borely unternimmt mit dem größten Teil des Expeditionskorps gerade einen dreitägigen Marsch, sodass ich nur Bertrand und 20 Mann bei mir habe. Im Umkreis von 13 Meilen liegt kein einziges Dorf, noch kreuzt ein Fußpfad die unmittelbare Umgebung; über allen Dingen regiert die Stille der Natur.
Eines Tages in der Früh, es mag eben sieben Uhr sein, sitzen die Leute rund um ihre Lagerfeuer. Die Sonne ist nun durchgebrochen. Lautlos brechen wir auf und teilen uns in zwei Gruppen. An den beiden vergangenen Tagen ließen sich jeweils Elefanten fährten.
Eines Tages in der Früh, es mag eben sieben Uhr sein, sitzen die Leute rund um ihre Lagerfeuer. Die Sonne ist nun durchgebrochen. Lautlos brechen wir auf und teilen uns in zwei Gruppen. An den beiden vergangenen Tagen ließen sich jeweils Elefanten fährten.
In diesem Distrikt kommt flächendeckend ein bestimmter Baum, der Fula (Marulabaum), vor, dessen Frucht das Aussehen einer wilden Mandel hat, die von süßem, duftendem Fruchtfleisch umgeben ist; die Elefanten sind geradezu verrückt danach. Da es sich bei den Fulas um gigantisch mächtige Bäume handelt, die sogar Elefanten nicht schütteln können, müssen sich letztere eben gedulden, bis die begehrten Früchte von selbst zu Boden fallen.
Die Dickhäuter haben unserem Gebiet schon einen Besuch abgestattet, jene Fulas umkreist und festgestellt, dass noch keine Früchte am Boden lagen. Also sagten sie sich wahrscheinlich: Wir wollen in einer Woche wiederkommen. Das ist es, worauf wir Jäger warten.
Die Dickhäuter haben unserem Gebiet schon einen Besuch abgestattet, jene Fulas umkreist und festgestellt, dass noch keine Früchte am Boden lagen. Also sagten sie sich wahrscheinlich: Wir wollen in einer Woche wiederkommen. Das ist es, worauf wir Jäger warten.
Tambarika marschiert mit fünf oder sechs Begleitern nordwärts. Wir anderen nehmen die Fährtensuche in südlicher Richtung auf, kehren jedoch gegen drei Uhr nachmittags ins Camp zurück, ohne auch nur irgendwo eine Spur von Elefanten gefunden zu haben. Weil im Lager dringend Frischfleisch benötigt wird, wollen wir um diese frühe Tageszeit einen Büchsenschuss riskieren; sollten die Elefanten tatsächlich kommen (und sie kommen in der Regel am Abend oder in der Nacht), so würden sie hierdurch noch nicht gestört. In einem Elefantenjagdgebiet muss man stets jeglichen Lärm vermeiden.
So rücken wir wieder aus und folgen den Büffeln, die bereits nach einer halben Stunde zu sehen sind; sie äsen friedlich auf einem Hügel. Wir umschlagen diese Anhöhe, pirschen vorsichtig bis auf 100 Yards heran und überblicken bald die ganze Herde. Sie besteht aus insgesamt 15 Stück, darunter allerdings nur drei ausgewachsene männliche Exemplare. Einer der Bullen wirkt besonders mächtig; er zieht bedächtig umher, auf seinem Rücken hockt eine Anzahl insektenfressender Vögel, die mit ihren Flügeln flattern und beträchtlichen Lärm machen.
Da der gewaltige Bulle, nach dem ich in erster Linie trachte, ungünstig platziert und überdies zu weit entfernt steht, will ich mich mit demjenigen Büffel begnügen, der mir am einfachsten zu treffen scheint. Folglich setze ich diesem eine Kugel aufs Blatt in der Hoffnung, er werde im Feuer fallen. Indes stürmt auf den Schuss hin die gesamte Herde flüchtig davon. Wir folgen der Wundfährte des angeschweißten Bullen gehen dabei sehr behutsam vor, denn die Nachsuche führt durch ein Gelände mit äußerst dichtem Unterwuchs und finden in Kürze unsere verendete Beute.
Die Hörner dieses Bullen waren wirklich prachtvoll. Wie schade, dass ich auf seinen älteren Kollegen, dessen Trophäe noch viel kapitaler war, verzichten musste!
Feuerameisen
Gegen halb sieben Uhr abends ist das Wildbret in Viertel zerwirkt im Camp eingebracht, und wir beginnen, daraus Biltong (Trockenfleisch) zu bereiten. Um elf Uhr in der Nacht geben uns die Löwen ein großartiges Konzert, ziehen aber bald weiter. Alle schlafen bereits, als plötzlich jemand laut ausruft: Litumbui, litumbui! den Namen der großen, fleischfressenden Ameisen, die angelockt von am Boden verstreuten Wildbretstückchen und Schweißspritzern soeben in dichtgeschlossenen Reihen unser Lager überfallen. Sämtliche Männer springen auf, fachen die erlöschenden Feuer erneut an und schlagen diese Invasion mithilfe von Brandfackeln zurück. Nachdem ich selbst wirklich nicht mehr gestört werden möchte, häufe ich glühende Asche rund um die vier eisernen Steher meines Feldbetts und gehe wieder ruhig schlafen. Noch einmal treten die Litumbui zum Angriff an, werden unter hohen Verlusten abermals abgewiesen.
Gegen halb sieben Uhr abends ist das Wildbret in Viertel zerwirkt im Camp eingebracht, und wir beginnen, daraus Biltong (Trockenfleisch) zu bereiten. Um elf Uhr in der Nacht geben uns die Löwen ein großartiges Konzert, ziehen aber bald weiter. Alle schlafen bereits, als plötzlich jemand laut ausruft: Litumbui, litumbui! den Namen der großen, fleischfressenden Ameisen, die angelockt von am Boden verstreuten Wildbretstückchen und Schweißspritzern soeben in dichtgeschlossenen Reihen unser Lager überfallen. Sämtliche Männer springen auf, fachen die erlöschenden Feuer erneut an und schlagen diese Invasion mithilfe von Brandfackeln zurück. Nachdem ich selbst wirklich nicht mehr gestört werden möchte, häufe ich glühende Asche rund um die vier eisernen Steher meines Feldbetts und gehe wieder ruhig schlafen. Noch einmal treten die Litumbui zum Angriff an, werden unter hohen Verlusten abermals abgewiesen.
Der nächste Tag verläuft ohne Zwischenfälle; unser Spähtrupp kehrt in Begleitung zweier Eingeborener zurück, die mich im Auftrag des Häuptlings eines benachbarten Dorfes zu sprechen wünschen. Anscheinend gibt es dort einen Löwen, der zwei Tage zuvor eine alte Frau aus der besagten Siedlung aufgefressen hat und sich in der letzten Nacht erneut in der Nachbarschaft herumtrieb. Für präzise Informationen über das Auftreten von mir gesuchter Wildarten habe ich eine Prämie ausgesetzt; dies ist allgemein bekannt, und nun kommen die beiden, um mich zu benachrichtigen.
Der betreffende Ort des Geschehens befinde sich, was die Eingeborenen Pafubi! ganz in der Nähe! nennen. Wir brechen unverzüglich auf, erreichen gleichwohl nach vierstündigem Fußmarsch jenes Dorf erst bei Einbruch der Dunkelheit. Es folgt eine pechschwarze Nacht, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was in solcher Finsternis sinnvoll unternommen werden könnte. Demgemäß scheint es am vernünftigsten, das Tageslicht abzuwarten. Den Dorfbewohnern rate ich, ihre Hütten in dieser Nacht ja nicht zu verlassen. Morgen hingegen sollte es uns möglich sein, einer frischen Spur des Löwen zu folgen.
Jetzt ist es auch schon zu spät, um eine Nachtwache zu organisieren. Außerdem liegt nur zehn Gehminuten entfernt ein anderes Dorf, wo die Eingeborenen zum Klang der Tom-Toms (Trommeln) bis zehn Uhr abends tanzen; ich nehme an, dass dieses Gedröhn den Menschenfresser einigermaßen abhält.
Um halb fünf Uhr in der Früh vernehme ich auf einmal laute Rufe, ein erregtes Stimmengewirr, das vom besagten Dorf der Tänzer herübertönt. Ich stürze sofort hinaus, das Gewehr in der Hand, meine Männer folgen mir nach. Eine in Tränen aufgelöste Frau wirft sich händeringend zu meinen Füßen und schreit, der Löwe habe ihren Sohn geholt.
Um halb fünf Uhr in der Früh vernehme ich auf einmal laute Rufe, ein erregtes Stimmengewirr, das vom besagten Dorf der Tänzer herübertönt. Ich stürze sofort hinaus, das Gewehr in der Hand, meine Männer folgen mir nach. Eine in Tränen aufgelöste Frau wirft sich händeringend zu meinen Füßen und schreit, der Löwe habe ihren Sohn geholt.
Durch die noch herrschende Dunkelheit, im flackernden Lichtschein der Strohfackeln, die die Eingeborenen mit sich tragen, rennen wir zu jener Siedlung. Wie Erkundigungen an Ort und Stelle ergeben, hat der Löwe den armen Jungen haargenau in dem Augenblick gepackt, als sein Opfer den Oberkörper durch die halbgeöffnete Hüttentür hinausbeugte, um auf der Schwelle gestapeltes Feuerholz zu ergreifen.
Mit den Eingeborenen ist es immer das Gleiche: Aus dem Missgeschick des einen lernen die anderen nie. Wie oft habe ich Schwarze exakt an jener Stelle baden sehen, an der nur wenige Tage zuvor ein Krokodil ihren Kameraden fortgerissen hatte! Es versteht sich von selbst, dass nach den schrillen Schreien der Dorfbewohner der Löwe nicht in deren Mitte geblieben war. Auch ist es unmöglich, bei Fackelbeleuchtung irgendwelche Spuren zu finden. So bleibt uns im Moment nichts anderes als Warten. Das Tageslicht wird demnächst erscheinen.
Wir finden die Fährte
Ich verbiete den Ortsbewohnern, in beliebiger Anzahl mitzukommen; lediglich zehn Männer sollen mich unter absolutem Stillschweigen begleiten. Sobald es hell genug ist, um einer Fährte zu folgen, nähern wir uns der betreffenden Hütte, von der das Kind verschleppt wurde. Die Füße der zuvor in der Nacht dort herumtrampelnden Leute haben alle Spuren vernichtet. Doch auf der kleinen Veranda, die die Hütte umgibt, kann man einen Krallenabdruck der Raubkatze erkennen, und kurz danach finden wir hinter dem winzigen Gebäude auch ihre Fährte.
Ich verbiete den Ortsbewohnern, in beliebiger Anzahl mitzukommen; lediglich zehn Männer sollen mich unter absolutem Stillschweigen begleiten. Sobald es hell genug ist, um einer Fährte zu folgen, nähern wir uns der betreffenden Hütte, von der das Kind verschleppt wurde. Die Füße der zuvor in der Nacht dort herumtrampelnden Leute haben alle Spuren vernichtet. Doch auf der kleinen Veranda, die die Hütte umgibt, kann man einen Krallenabdruck der Raubkatze erkennen, und kurz danach finden wir hinter dem winzigen Gebäude auch ihre Fährte.
Seitlich davon hat ein Fuß des Kindes Schleifspuren hinterlassen der Menschfresser muss den Buben oben am Kopf oder Hals gepackt haben. Die Bestie folgte einer der zum Fluss führenden Dorfstraßen, wobei sie mit ihrer Last mehr als 20 Hütten passierte. So erreichen wir das Ufer des Wasserlaufes, wo wie eine kleine Blutlache anzeigt der Löwe angehalten und sein Opfer neben sich abgelegt hat. Dann überquerte der Menschenfresser den damals etwa ein Fuß tiefen Fluss, zog ein paar Yards weit stromabwärts und wechselte schließlich in das am gegenüberliegenden Ufer angrenzende Schilf.
Bevor wir ihm dorthinein folgen, sende ich Tambarika aus, um nachzusehen, ob am weit entfernten Rand dieses dichten Unterwuchses etwa eine Fährte zu erkennen sei. Ein wohlbekannter Pfiff bestätigt uns, dass dem tatsächlich so ist; so können wir den Fußpfad nehmen, um schneller voran zu kommen. Nach Durchqueren einer Graspartie eine frische Blutlache zeugt von einem neuerlichen Halt erreichen wir eine kleine Ebene; nach wie vor befinden wir uns auf der Fährte des nächtlichen Missetäters.
Bevor wir ihm dorthinein folgen, sende ich Tambarika aus, um nachzusehen, ob am weit entfernten Rand dieses dichten Unterwuchses etwa eine Fährte zu erkennen sei. Ein wohlbekannter Pfiff bestätigt uns, dass dem tatsächlich so ist; so können wir den Fußpfad nehmen, um schneller voran zu kommen. Nach Durchqueren einer Graspartie eine frische Blutlache zeugt von einem neuerlichen Halt erreichen wir eine kleine Ebene; nach wie vor befinden wir uns auf der Fährte des nächtlichen Missetäters.
Als nächstes führt die Fährte in einen Wald; darin stoßen wir auf geronnenes Blut, weiterhin auf eine Glasperlenkette, die der kleine Junge um die Hüften getragen hatte, sowie seinen an einem Dornbusch abgestreiften Lendenschurz. Eine riesige Blutlache markiert die Stelle, wo das Raubtier begann, sein Opfer in Stücke zu reißen; dies muss allerdings schon mehr als eine Stunde zurückliegen. Zuletzt, am anderen Ende des Waldes, gelangen wir in hohes Gras, als uns ein drohendes Grollen schlagartig anhalten lässt. Hier ist unser Gegner! Wird er nun angreifen?
Vorerst ist nichts mehr zu hören. Ich spanne sorgfältig meine Doppelbüchse, die Repetierflinte geladen mit sechs Schuss groben Posten befindet sich auf Armlänge hinter mir. Ein nochmaliges Überdenken, ob alles bereit ist dann dringe ich, den Finger am Abzug, in den dichten Grasdschungel ein. Meine Augen sind direkt nach vorne gerichtet, die Ohren bis aufs Letzte gespitzt, auch die Füße bewegen sich völlig geräuschlos.Etwa zehn Yards vor uns raschelt es jetzt im Gras; man sieht, wie sich die Stängelspitzen bewegen aber auch nicht mehr als das! Ganz langsam rücken wir weiter vor. Ah! Hier, zu meiner Rechten, ist ein Baum! Ein vorsichtiges Handzeichen zu Kambombe der wie ein Affe klettern kann , und im Nu sitzt dieser schon in einer Astgabel am Auslug: Hier ist das Kind, berichtet er in gedämpftem Ton, aber kein Löwe… Dann, nach eine Kopfdrehung nach rechts: Da ist er! Schnell, in diese Richtung!
Geleitet durch die Gesten meines Spähers, stürme ich nach rechts. Aufgrund eines spontanen Gedankens, winke ich nun die nachfolgenden Dorfbewohner herbei und signalisiere ihnen mit einer Armbewegung, die Grasinsel links zu umgehen. Zugleich weise ich durch Rodzani als Boten die Leute an, sie sollen dort heftigen Lärm machen und so den Löwen auf mich zutreiben. Ich beziehe an einer winzigen Lichtung Position, stehe absolut regungslos alle meine Sinne auf jenes Buschviereck gerichtet, aus dem ich den Menschenfresser erwarte.
Kambombe informiert mich mit leiser Stimme laufend von seinem Baum aus: Er ist weg… Nein, da kommt er wieder… Er bleibt stehen und äugt in die Richtung der Männer… Jetzt hebt er das bemähnte Haupt… Ah, er zieht in deine Richtung!… Er trollt im Schritttempo… Jetzt ist er gleich beim Ameisenhaufen… Ah, wärest du bloß hier droben!… Er äugt hinter sich… Da ist er! Da ist er!… Geh zurück; geh zurück!
Der Löwe kommt
Man kann sich vorstellen, mit welcher Spannung ich diesen Worten lausche. Ich befolge Kambombes Anweisung und trete zwei Schritte retour. Die Männer hinter mit halten ihre Waffen bereit. Schießt nur im Notfall ermahne ich sie. Übereile nichts, murmelt Tambarika.
Man kann sich vorstellen, mit welcher Spannung ich diesen Worten lausche. Ich befolge Kambombes Anweisung und trete zwei Schritte retour. Die Männer hinter mit halten ihre Waffen bereit. Schießt nur im Notfall ermahne ich sie. Übereile nichts, murmelt Tambarika.
Das raschelnde Gras neigt sich vorwärts, öffnet sich dann nach beiden Seiten und der Löwe erscheint acht Yards von mir entfernt. Noch äugt er zurück, der Lärm hinter ihm nimmt seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch. Dann dreht er sein Haupt und sieht mich bewegungslos vor ihm stehen.
Das mächtige Raubtier fletscht die Zähne und knurrt wütend, ohne jedoch von seinem Weg abzuweichen. Gleichzeitig geht der Schwanz in die Höhe, der Löwe legt die Gehöre an; ich weiß, jetzt kommt der Angriff, bin mit meiner Büchse mitgefahren, ziele genau aufs Genick, drücke ab. Im Schuss brechen alle vier Läufe ein und ohne weitere Bewegung fällt der Menschfresser verendet um!
Ich hatte auf die Präzision meiner .303 gesetzt. Es war übrigens ein Hohlgeschoss, mit dem mir dieser glänzend wirkende Treffer gelang; seither habe ich solche Projektile noch oft erfolgreich verwendet. Die Raubkatze muss dabei an dem Punkt getroffen werden, wo der Hals endet und der Schädel beginnt, genau mitten auf der dicksten Stelle des Genicks und sie wird mausetot umfallen. Wenn man auf so geringe Distanz feuert, muss man berücksichtigen, dass alle einschlägigen Jagdbüchsen einen Hochschuss aufweisen die Metford sogar mehr als jede andere; demzufolge hat man daher beträchtlich unter dem gewünschten Treffpunkt anzuhalten. Jenseits einer Entfernung von 120 Yards steigt hingegen die Kugel nicht mehr. Lesen Sie weiter auf Seite 80.
Ich hatte auf die Präzision meiner .303 gesetzt. Es war übrigens ein Hohlgeschoss, mit dem mir dieser glänzend wirkende Treffer gelang; seither habe ich solche Projektile noch oft erfolgreich verwendet. Die Raubkatze muss dabei an dem Punkt getroffen werden, wo der Hals endet und der Schädel beginnt, genau mitten auf der dicksten Stelle des Genicks und sie wird mausetot umfallen. Wenn man auf so geringe Distanz feuert, muss man berücksichtigen, dass alle einschlägigen Jagdbüchsen einen Hochschuss aufweisen die Metford sogar mehr als jede andere; demzufolge hat man daher beträchtlich unter dem gewünschten Treffpunkt anzuhalten. Jenseits einer Entfernung von 120 Yards steigt hingegen die Kugel nicht mehr. Lesen Sie weiter auf Seite 80.
Bei meiner Beute handelte es sich um einen sehr alten Löwen von durchschnittlicher Größe, der extrem abgekommen war. Seine unmittelbar nach der Erlegung genommenen Maße lauten: Gesamtlänge neun Fuß und ein Zoll (277 cm), Schulterhöhe zwei Fuß und elf Zoll (89 cm), Umfang der Vorderpranke ein Fuß und fünf Zoll (43 cm).
Der vom Löwen verschleppte Junge mochte etwa 14 Jahre alt gewesen sein; er wurde nahezu im selben Moment gepackt und getötet. Raubkatzen tragen niemals eine zappelnde Beute davon, es sei denn, sie werden beim Riss überrascht. Unserem Löwen aber stand reichlich Zeit zur Verfügung, sein Opfer zu töten: Dessen Mutter hatte einen Schrei gehört und sogleich die schreckliche Wahrheit erraten; ihr Entsetzen war jedoch so groß, dass ihr schlicht die Kraft fehlte, unverzüglich loszuschreien. Als sie dann nach draußen ging, war es zu spät.
Die Körper der beiden an dieser nächtlichen Tragödie Beteiligten brachten wir ins Dorf zurück. Jener des Kindes wies tiefe Bisswunden auf, die den Hals und die rechte Schulter furchtbar verstümmelt hatten; weiterhin war eine seiner Hüften bis auf den Knochen zerfleischt. Der Löwe wurde von acht Männern heimgetragen, wo sich die Bevölkerung sofort mit Flinten, Pfeilen und Lanzen auf den toten Räuber stürzen wollte.
Es ist in solchen Fällen Brauch, den Körper des Tieres mit Flintenschüssen und Messern zu verstümmeln, bis dessen Decke einem Sieb gleicht. Verständlicherweise war ich mit dieser Präparation meiner Jagdtrophäe nicht einverstanden. Also trat ich dazwischen und erklärte den Eingeborenen, ich hätte den Menschenfresser für sie zur Strecke gebracht, demnach beanspruchte ich auch seine unversehrte Decke samt Krallen und Haupt; anschließend würde ich ihnen die Reste überlassen. Ich fügte hinzu, dass ich nun den Löwen aus der Decke schlagen würde, und dass der erste, der ihn zuvor anfasste, meinen Stock zu spüren bekäme.
Die gesamte Einwohnerschaft nahm nun im Umkreis Platz und wartete geduldig, bis Tchigallo, unterstützt von Rodzani und Msiambiri, das sachgerechte Abhäuten meiner Beute beendet hatte. Dann stürmten sie auf den Löwenkern los, durchsiebten ihn mit Projektilen, stachen mit Lanzen darauf ein und schleiften den kopf- und fußlosen Kadaver, der jetzt entfernt einem für die Metzgerei zugerichteten Ochsen ähnelte, durch alle benachbarten Dörfer. Später wurden inmitten von Wehklagen der Frauen, wilden Begräbnistänzen und sonstigem Tumult, die Überreste des Löwen auf einem riesigen Holzfeuer verbrannt.
Noch auf halber Strecke unserer Rückreise zum Camp hörten wir die schrillen Schreie der Eingeborenen und das Gedröhn der Tom-Toms. Erst bei Einbruch der Dunkelheit verriet uns der schwache Schein des am Horizont verglimmenden Scheiterhaufens das Ende jenes Sühnerituals.
Als ich abends den mit Sternen übersäten Himmel betrachtete, musste ich noch immer an die arme Schwarze dort drüben denken, an ihr verzweifeltes Mutterherz und ich fragte mich, wieviele solch unbekannt bleibender Leiden sich wohl alltäglich im Universum ereignen.
Hansgeorg Arndt