30 Vertreter von staatlichen Jagdverwaltungen, Berufsjäger- und Naturschutzorganisationen waren Mitte Oktober 2001 in Simbabwes Hauptstadt Harare zusammengekommen, um neue Wege für die Jagd im südlichen Afrika zu erörtern
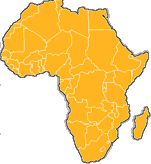 |
Die blühenden Jakarandabäume setzen violett-rosa Tupfer entlang der Alleen in der Innenstadt und machen vergessen, dass nur 50 Kilometer weiter hunderte von Farmen durch gewalttätige Politvandalen besetzt gehalten werden und das Menschenrecht auf Unversehrtheit von Leben und Eigentum außer Kraft gesetzt ist.
Auch jagdlich schwankt die Region zwischen Extremen. Während in Simbabwe jeden Monat ein paar Jagdgäste verprügelt werden, herrscht in Namibia eine schon als deutsch zu bezeichnende jagdliche Ordnung, ja, wenn zu Hause in Deutschland die jagdliche Welt noch so ordentlich wäre. Und während in Südafrika meist auf eingezäunten Farmen auf Antilopen gejagt wird, dominiert in Tansania noch die klassische Safarijagd auf Großwild und das Zeltcamp in echter Wildnis a la Hemingway.
Sambia hat gerade die Jagd für Ausländer ein Jahr lang gesperrt, gleichzeitig ist Mosambik geradezu rührend bemüht, die Jagdmöglichkeiten auszuweiten, um dem bitterarmen Land ein paar Devisen zu verdienen.
Doch der Reihe nach.
Simbabwe
Im Gastland Simbabwe hat zwar die Regierung zugesichert, dass landwirtschaftlich ungeeignete Jagdfarmen wieder geräumt werden. Geschehen ist aber nichts.
Auch das mit Großbritannien kürzlich abgeschlossene und auf mehr Rechtsstaatlichkeit der Landreform gerichtete Abuja-Abkommen wird nicht umgesetzt. Während der Konferenz wurde bekannt, dass auf der großen Save Conservancy gerade ein Wildhüter von einem Wilderer mit Pfeil und Bogen ermordet wurde.
Solche Delikte gelten als politisch motiviert und werden in der Regel von der Polizei nicht verfolgt. Dies gilt auch für die enorme Wilderei auf den besetzten Farmen.
Die Jagd auf Staatsland ist von den Unruhen weitgehend unberührt und hat in den letzten zwei Jahren auch nur einen ganz geringen Rückgang erlitten, ganz anders als der normale Tourismus, der völlig eingebrochen ist.
Der Vertreter der Jagdführer, George Pangeti, verbreitet Zuversicht und setzt auf eine baldige Normalisierung.
Sambia
Wenig Gutes wurde auch aus Sambia berichtet. Wahlen stehen vor der Tür, und angeblich unterstützen einige Jagdfirmen die Opposition.
Da schien es Präsident Chiluba angebracht, über Nacht die Gästejagd zu verbieten. Denn Firmen, die kein Geld verdienen, können auch nicht den Wahlkampf der Gegenkandidaten bezahlen.
Allerdings finanziert sich auch die halbstaatliche Wildschutzbehörde „ZAWA“, die bei der rein parteipolitisch motivierten Entscheidung nicht konsultiert wurde, normalerweise mindestens zur Hälfte aus den Jagdgebühren.
Acht Millionen Euro fehlen auf diese Weise. Der Fototourismus spült nur etwas über 500 000 Euro in die Kassen, und vom Staat kommen in diesem Jahr statt 3,5 Millionen Euro Zuschuss gerade einmal 500000 Euro.
ZAWA ist pleite: Die Wildhüter haben schon zwei Mal wegen ausbleibender Gehälter gestreikt, und die Wilderer nutzen jetzt ihre Chance in den Nationalparks und Jagdblocks. Überall wird Wild massakriert .
Auch die Dörfer in den Jagdgebieten, die bislang ein Drittel der Einnahmen erhielten, gehen leer aus. ZAWA versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
Die Jagdblocks werden nach einer Ausschreibung neu vergeben. Man hofft, dass das auf ein Jahr befristete Jagdmoratorium, das im übrigen für die Jagd der Einheimischen nicht gilt, bald vorüber ist. „Augen zu und durch“ heißt die Devise.
Botswana
Auch Botswana hat unter einem Jagdverbot zu leiden. Die Löwenjagd wurde eingestellt, und zwar wegen ein paar einflussreicher weißer Tierschützer.
Ein bekannter Tierfilmer hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Er filmt seit Jahren nachts im Scheinwerferlicht Löwen.
Beobachter berichten von elender Tierquälerei, und dass manche Rudel nur noch mit Hilfe der Scheinwerfer jagen. Ein Mehrfaches an Löwen, die von Gastjägern erlegt werden, wird im übrigen alljährlich zum Schutz der Kühe abgeschossen, und die Tendenz ist steigend, weil man mit Löwen kein Geld mehr verdienen kann.
Ohnehin beklagt man einen Rückgang der Wildbestände. Dabei sind 17 Prozent des Landes unter Naturschutz gestellt, und weitere 22 Prozent sind Jagdgebiete, in denen nur geringe Mengen an Wild entnommen werden.
Die Jagdquote beträgt gerade einmal 16 000 Stück Wild: zum Beispiel 162 Büffel, 79 Leoparden, 170 Wildebeest, 1296 Springböcke oder 180 Elefanten.
Der wichtigste Grund für den Rückgang des Wildes sind die großen Veterinärzäune, die das Land durchschneiden und vor allem den wenigen Rinderbaronen nutzen, die ganz oben in der Regierung sitzen.
Die Trophäenqualität ist weiterhin gut und steigend, berichtete Debbie Peake, eine Vertreterin der Wildindustrie. Durch ihren Präparationsbetrieb in Maun laufen 90 Prozent aller ausgeführten Trophäen, die auch von ihr vermessen werden.
Sie verweist darauf, wie wichtig die Entwicklung der Trophäenstärke für die Kontrolle der Nachhaltigkeit der Entnahme ist. Über 12 Millionen Euro Umsatz macht die Jagdindustrie mit rund 200 Auslandsjägern im Jahr.
Im letzten Jahr wurden die Lizenzgebühren drastisch erhöht, nachdem sie zwölf Jahre lang nicht verändert worden waren.
Mosambik
Das Nachbarland Mosambik begann mit der Jagd erst wieder im Jahre 1993, nachdem der 16-jährige Bürgerkrieg vorbei war, der vielerorts die Wildbestände dezimiert und ausgerottet hatte.
Es gibt 13 Jagdgebiete mit insgesamt 51000 Quadratkilometern, von denen eines gerade aber mit deutscher Entwicklungshilfe in einen Nationalpark umgewandelt wird (siehe Jagen Weltweit 5/2001).
Ob dies angesichts nicht vorhandener Touristen sinnvoll ist, wird in Mosambik angezweifelt. Die deutsche Entwicklungshilfe hat sich offensichtlich von den südafrikanischen Propagandisten der sogenannten „Friedensparks“ betören lassen, die viele Beobachter vor Ort mehr als einen PR-Gag ansehen.
Grenzüberschreitende Naturschutzgebiete sind eine gute Idee, aber es wird wohl noch lange dauern, bis Tourismus ohne Schlagbäume möglich ist. Derzeit dient das Programm in erster Linie als Staubsauger für Hilfsgelder aus den Industrieländern.
Die Jagdblocks sind langfristig verpachtet. Die staatliche Verwaltung ist weiterhin unorganisiert, und die Einnahmen aus der Jagd sind gering. An einem Büffel verdient der Staat gerade einmal 100 Euro.
Es kommen nur wenige Jagdgäste, die im Jahr um die 340 Stück Wild erlegen, beispielsweise 75 Büffel, 22 Löwen, 23 Leoparden, 21 Rappenantilopen oder 23 Warzenschweine. Elefanten sind zur Jagd nicht freigegeben.
Tansania
Fast 40 Jagdfirmen wetteifern im ostafrikanischen Tansania um die Gunst der Jäger aus aller Welt, und sie haben Großwild und Plainsgame in großer Zahl und Vielfalt anzubieten (siehe den Beitrag über Tansania in der Heft-Ausgabe).
Löwen, Büffel und Leoparden sind die Renner. Die Jagdblocks werden nicht versteigert, sondern vom Game Department vergeben.
Aber fehlender Wettbewerb begünstigt Vetternwirtschaft und Schlimmeres. 8000 Euro werden für einen Jagdblock bezahlt, und tansanische Firmen sichern sich erst einmal einen Block und suchen dann einen Partner, der die Kunden bringt und die Jagd durchführt.
Die Jagdquoten sind in den meisten Gebieten angemessen. Mancherorts wurden jedoch die Jagdgebiete halbiert und die Quoten verdoppelt.
Bei der Einhaltung der Artenschutzbestimmungen erhält Tansania heute gute Noten.
Südafrika
Seitdem das Land am Kap nicht mehr von einer weißen Minderheitsregierung geführt wird, hat es seinen Paria-Status verloren und dominiert die Region wirtschaftlich.
Auch in der Jagdwirtschaft der Nachbarländer sind inzwischen südafrikanische Firmen und Berufsjäger führend. Vor allem ist aber erstaunlich, wie erfolgreich das Land sein Wild vermarktet, das von den Zahlen mit einem Land wie zum Beispiel Tansania konkurrieren kann.
Aber: Südafrika ist das einzige Land in Afrika, das weiterhin die „Big Five“ bieten kann, vielleicht weil hauptsächlich auf privatem Land gejagt wird. 70 Prozent der Jagdgäste kommen aus den USA, und das Marketing dort lassen sich die Südafrikaner jedes Jahr über 500 000 Euro kosten. 40 bis 45 Millionen Euro Einnahmen bringen die 3500 ausländischen Jagdgäste im Jahr.
Die Hälfte sind Abschussgebühren, ein Viertel Tagessätze (30000 Jagdtage) und ein weiteres Viertel Trophäenpräparation. Dennoch geben die Südafrikaner selbst das Doppelte für die Jagd aus. Die meisten von ihnen sind keine Trophäenjäger, sondern nur am Wildbret interessiert.
Damit erlöst Südafrika aus der Jagd etwa das Sechsfache von Tansania. Die Auslandsjäger erlegen 25000 Stück Wild im Jahr. Darunter 3200 Impala, 2900 Springböcke, 1600 Kudu, 150 Büffel, 95 Löwen und 20 Elefanten.
Mit 25000 Euro sind die weißen Nashörner am teuersten.
Davon werden jedes Jahr um die 40 Stück erlegt. Man bemüht sich ernsthaft, die Jagdgesetze zu verbessern, jagdliche Auswüchse zu verhindern und die Qualität der Berufsjäger, wie der Jagdausübung überhaupt, zu verbessern.
Eine Kontrolle der Trophäenqualität gibt es bislang nicht.
Namibia
Der Jagdtourismus hat auch in Namibia weiterhin steigende Tendenz. Er ist eine anerkannte Form der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen.
Ohne Jagd hätte Namibia nur einen Bruchteil seiner heutigen Wildbestände. Auch hier wird in erster Linie auf privaten Farmen gejagt, obwohl die Jagd auf Stammesland eine wichtigere Rolle spielt als in Südafrika.
Knapp zehn Prozent aller privaten Farmen sind als Jagdfarmen registriert.
Viele davon haben sich zu Hegegemeinschaften zusammengeschlossen, von denen es inzwischen 23 Stück mit einer Durchschnittsgröße von 182000 Hektar gibt.
Es gibt auch fünf dörfliche Jagdgebiete, die sich zu Hegegemeinschaften zusammengeschlossen haben, und die Tendenz ist steigend (siehe Jagen Weltweit 5/2001).
Staatliche Jagdkonzessionen werden für drei Jahre versteigert, und diese Konzessionen kosten im Jahr über 200000 Euro.
Namibia hat auch ein gut entwickeltes System der Qualitätskontrolle bei Trophäen. So sehr die Jagd politisch als beste Form der Landnutzung in Trockengebieten akzeptiert ist, so sehr muss sich doch die Industrie bemühen, die schwarze Bevölkerungsmehrheit verstärkt zu integrieren.
Bislang wird in Namibia nicht über Farmbesetzungen gesprochen. Aber es fällt auf, dass die Regierung von Sam Nujoma auch nicht kritisiert hat, was in Simbabwe passiert, ebensowenig wie Thabo Mbeki von Südafrika dies getan hat. Dies gibt nicht nur Namibiern und Südafrikanern zu denken.
Fazit
Die Jagd ist überall ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, und ohne die Einnahmen aus der Trophäenjagd könnten die Wildschutzbehörden nirgendwo ihren Aufgaben nachkommen. Außerhalb der Nationalparks ist die Jagd die bei weitem lukrativste Form der Wildnutzung.
Sie birgt noch große Potentiale, die zu entwickeln sind. Auf Privatland ist die Jagd ein großer Anreiz für den Landeigentümer, Wild zu hegen – vorausgesetzt, das Gesetz erlaubt Eigentum an Wild oder zumindest private Nutzungsrechte. Private Jagdfarmen schließen sich zunehmend zu größeren Hegegemeinschaften zusammen.
Für die Jagd ist das genauso sinnvoll wie für den Naturschutz. Versuche, der Natur auf privaten Farmen etwas „nachzuhelfen“ und fremde, aber jagdlich interessante Tierarten einzuführen, werden zunehmend kritisiert.
Das Festsetzen der richtigen Quoten ist überall ein Problem. Privaten Landbesitzern sollte man möglichst viel Eigenverantwortung gewähren. Auf Staatsland ist die wissenschaftliche Beratung und Kontrolle wichtig; und sie muss verbessert werden.
Überall in der Region gibt es Initiativen, der lokalen Bevölkerung das Management von Wildbeständen auf Dorfland zu ermöglichen.
Wichtig ist dabei, dass die Erträge auch ganz unten in den Dörfern ankommen. Auch das simbabwische CAMPFIRE-Programm, ein Vorreiter dieser Politik, leidet daran, dass die Jagdeinnahmen an die sogenannten Councils, das heißt die Verwaltungsbürokratie, in den Distrikten fließen und nicht an die Bewohner selbst.
Die Campfire-Gemeinden schließen sich deshalb zu Trusts zusammen, um die Einnahmen selbst einstecken zu können.
„Kein Brot“ lautet die Schlagzeile einer Tageszeitung, die ein Zeitungsjunge auf dem Weg zum Flughafen ans Fenster hält. Simbabwes Regierung hat über Nacht die Brotpreise halbiert, und prompt bleiben die Regale leer.
Doch wer Devisen hat, die überall zum Fünffachen des staatlich festgelegten Bankkurses gewechselt werden, der kann weiterhin alles kaufen.
Afrikas Probleme sind zum großen Teil hausgemacht, und Schuld daran tragen nicht zuletzt schlechte Regierungen und korrupte Potentate.
Aber „c’est l’ Afrique “ sagen die Franzosen, die sich in diesem Teil der Welt besser auskennen, als viele wohlmeinende Weltverbesserer. Ich blicke ein letztes Mal auf die blühenden Jakarandas und betrete die leere Flughafenhalle.






